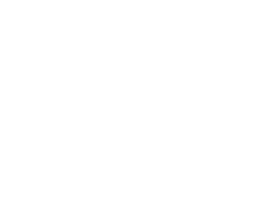von Robert Rauh
Fontane nennt es das große Ereignis Protzens während des vorigen Jahrhunderts: der Tod eines preußischen Prinzen im dortigen Herrenhaus. Gemeint ist das 18. Jahrhundert – die Zeit Friedrichs des Großen. Dieses Ereignis ist ungewöhnlich wie das Dorf, in dem sich die Tragödie abgespielt hat. Zehn Tage rangen hier die Ärzte um das Leben des erst neunzehnjährigen Prinzen, den Lieblingsneffen Friedrichs des Großen. Der König „liebte dieses Kind wie [s]einen eigenen Sohn“ und erwog sogar, ihn als Thronfolger zu bestimmen. Dass Friedrichs große Hoffnung ausgerechnet in dem kleinen märkischen Ort starb, ist ein Zufall der Geschichte.
Architektonischer Lichtblick
Wo liegt Protzen? Westlich, in unmittelbarer Nähe von Walchow liegt Protzen, ein ehemals wohlhabendes Luch- und Torfdorf wie jenes, schreibt Fontane in seinem ersten „Wanderungen“-Band „Die Grafschaft Ruppin“, in dem er dem Dorf ein Kapitel gewidmet hat. Protzen gehört zu den Ortschaften, die am Nordrand des Rhinluchs wie an einer Perlenkette (Dorfstraße L 165) aufgezogen sind. Rund 450 Menschen wohnen heute in dem Ort, der seit 2003 zur Gemeinde Fehrbellin gehört. Es ist ein lang gezogenes Straßendorf. Durchfährt man es von Osten, also von der Autobahn-Abfahrt über Walchow, braucht man eine gefühlte Ewigkeit bis Kirche und Gutshaus erreicht sind. Letzteres ist nicht zu übersehen. Das zweigeschossige Herrenhaus, das um 1755 errichtet wurde, strahlt mit seinem gelben Anstrich schon von weitem. Die Mitte der Hauptfront ist durch einen schwach vortretenden Resalit mit rundbogigem Hauptportal hervorgehoben. Über dem Portal befinden sich zwei Rosetten. In dem ansonsten unauffälligen Dorf ist das ehemalige Gutshaus ein architektonischer Lichtblick. Und ein Kulturstandort, mit dem sich tatschlich etwas protzen lässt. Es beherbergt ein Museum, mit dem sich viel Staat machen ließe. Nicht nur für Preußen-Fans.
Vorzeigeprinz
Der so jung verstorbene Prinz Carl Friedrich Heinrich von Preußen (1747-1767) wäre heute bereits völlig vergessen, meint der Medizinhistoriker Michael Sachs in seiner profunden Darstellung über Heinrich, wenn nicht nach dessen Tod sein Onkel, der preußische König Friedrich II., eine „ungewöhnlich warmherzige Gedenkrede“ publiziert hätte. An seinen Bruder schrieb der kinderlose Monarch, er liebe seinen Neffen „wie einen eigenen Sohn“. Für den Staat sei es ein großer Verlust, „[…] meine Hoffnungen sinken mit ihm ins Grab.“

Friedrichs große Hoffnung: Heinrich Prinz von Preußen, Ölporträt, ca. 1767.
Hinweis: Das Gemälde, für das als Maler sowohl Friedrich Reclam als auch Charles-Amédée-Philippe van Loo angegeben werden, hing ursprünglich im Berliner Hohenzollern-Museum (Schloss Monbijou).
Friedrich der Große setzte in Heinrich „festere Hoffnungen“ als in dessen älteren Bruder Friedrich Wilhelm, der nach dem Tod des Vaters der beiden Brüder 1758 der preußische Thronfolger war. Den Älteren, der späterer Friedrich Wilhelm II., charakterisierte Friedrich 1770 gegenüber seiner Schwester Ulrike als „plump, starrköpfig, launenhaft, liederlich und sittenlos, dumm und unerfreulich“. Ein völlig entgegengesetztes Bild zeichnete er von dessen jüngeren Bruder. In seiner Gedenkrede (Éloge) fand der als gefühlskalt geltende König rührende Worte für seinen Lieblingsneffen: Heinrich sei „stets guter Laune, mäßig in seinen Sitten, geschickt in allen Leibesübungen, beharrlich in seinen Unternehmungen, unermüdlich in der Arbeit und ein Freund von allem, was nützlich und ehrenvoll ist. So viele hervorragende Talente, mit denen die Natur Prinz Heinrich begabt hatte, würden jedoch kein vollkommenes Lob ausmachen, ohne die Eigenschaften des Herzens, die für alle Menschen, besonders aber für die Großen so wichtig sind. Sie setzten seinem Charakter erst die Krone auf.“ Als die Gedenkschrift am 30. Dezember 1767 in der Berliner Akademie der Wissenschaften verlesen wurde, saß der Thronfolger im Publikum. Friedrich, der in seiner Éloge das Bild eines vorbildlichen Herrschers zeichnete und damit auch sich selbst meinte, schätzte seinen Neffen vor allem für dessen militärisches Talent. Ob auch homoerotische Gefühle für den anmutigen, gutaussehenden Heinrich eine Rolle spielten, muss angesichts fehlender Nachweise ungeklärt bleiben.
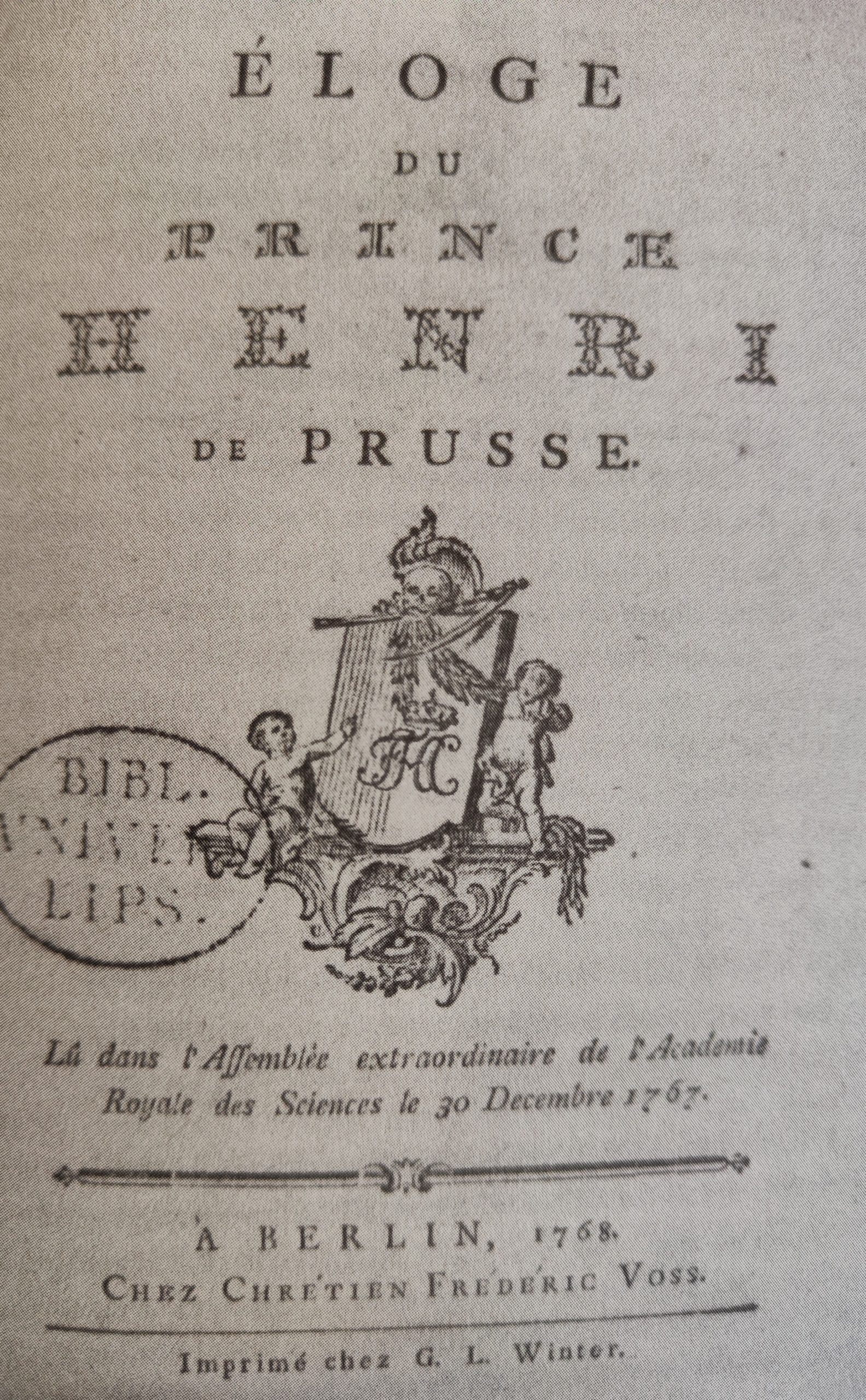
Gedenkrede für den Lieblingsneffen: Éloge du Prince Henri de Prusse von Friedrich II., Titelbild der französischen Erstausgabe von 1767
Foto: Archiv Rauh
Zehn Tage in Protzen
Der preußische Vorzeigeprinz, der schon mit neunzehn Jahren eine militärische Bilderbuchkarriere vorweisen konnte, gehörte nach dem Siebenjährigen Krieg (1756-1763) zu den regelmäßigen Mittagsgästen des Königs und begleitete diesen auf seinen Inspektionsreisen durch die Provinzen, schreibt Fontane. Im April 1776 siedelte der Prinz nach Kyritz über, um die Führung eines Regiments zu übernehmen. Bereits einen Monat später ging es zurück nach Berlin, weil Heinrichs Regiment an der Frühjahrs-Revue, der Truppenmusterung durch den König, teilnehmen sollte. Unmittelbar vor dem Marsch wurde Heinrich krank. Der Krankheitsverlauf des Prinzen ist detailliert dokumentiert, weil fast alle Berichte der behandelnden Ärzte – bis auf die letzten drei Lebenstage – überliefert sind. Sie mussten dem König täglich Bericht erstatten. Fontane kannte die Krankheitsakte nicht.
Am 15. Mai, dem Tag des Marschbefehls, klagte Heinrich erstmals über Unwohlsein. Einen Tag später erwachte er mit Fieber und erlitt beim Aufstehen einen Ohnmachtsanfall, sodass er seinem Regiment, das bereits von Kyritz nach Fehrbellin aufgebrochen war, verspätet in einem Wagen folgte. Weil die Fieberschübe zunahmen, machte er in Protzen Station, wo der Prinz von der Witwe des Generalleutnants Franz Ulrich von Kleist aufgenommen wurde. Heinrich kam im Giebelzimmer des Gutshauses unter, das er nicht mehr lebend verlassen sollte. Am 17. Mai hatten die Ärzte Gewissheit, dass es sich um Pocken handelte. Zum andauernden Fieber erlitt der Prinz Nasenbluten. Am 18. Mai kam Dr. Cothenius, der Leibarzt des Königs, nach Protzen. Einen Tag später Heinrichs Bruder, Thronfolger Friedrich Wilhelm.
Der Prinz wurde nun rund um die Uhr überwacht. Zunächst verbesserte sich der Zustand etwas; am 22. Mai nahm das Fieber und die Gesichtsschwellung allerdings wieder zu. Letztendlich blieben die Ärzte machtlos. Am Abend des 26. Mai 1767 starb der Prinz an den „Blattern“. Sachs kommt zu dem Schluss, dass die behandelnden Ärzte „die Gefährlichkeit der Erkrankung nicht richtig eingeschätzt und den König nicht rechtzeitig vorgewarnt“ hätten. Ob der Prinz andernfalls hätte gerettet werden können, schreibt er leider nicht.
In den „Wanderungen“ zitiert Fontane den Sterbeeintrag im Protzener Kirchenbuch: Zwei Tage später wurde die hohe Leiche durch Offiziere unter Leuchtung vieler Lichter in das hiesige Gewölbe gesetzet und am 7. Juni, als am ersten Pfingsttage, von hier aus nach Berlin gebracht. „So ist das Leben!“, schrieb der König unmittelbar nach dem Tod an seinen Bruder Heinrich. „Man hat nichts davon als den Schmerz, seine teuersten Anverwandten begraben zu müssen.“
Weder Heinrich noch Fontane
Aus Anlass des 250. Todestages stellte die damalige Museumsleiterin Elke Wildt 2017 erstmals Heinrichs zehntägige Leidensgeschichte im Entrée des Protzener Gutshauses aus. Zu sehen waren Auszüge aus der Krankenakte und die Sterbeurkunde aus dem Kirchenbuch. Als ich die Museumsleiterin Elke Wildt fragte, warum dem Prinzen in der Dauerausstellung kein eigner Raum gewidmet wurde, gab sie eine pragmatische Antwort: „Der Prinz war nur zehn Tage in Protzen.“ Faktisch hat sie natürlich Recht. Und es beirrte sie auch nicht, dass ihr schon vor Jahren ein Mitarbeiter der Schlösser-Stiftung geraten hatte, die Geschichte mit dem Prinzen „ganz groß aufzuziehen“. Außerdem – so ist aktuell auf der Homepage zu lesen (Oktober 2025) – fokussiert sich der Protzener Insel-Verein, der das Museum im Gutshaus betreibt, „auf die Zeit seit 1945 bis in die 2000er Jahre“.
Die Protzener halten Maß: nennen ihr Gutshaus nicht Schloss, präsentieren keine Herrscher-, sondern die Alltagsgeschichte. Und widerlegen die hundertfünfzig Jahre alte Unterstellung des großen Wanderers, wonach unsere Mark […] auf jedem Gebiet immer den Mut der ausgleichenden höheren Titulatur gehabt hätte. Aber auch Fontane wird in Protzen nicht ausgestellt. Leider zu Recht. Denn es gibt keinen Nachweis, dass er den Ort auf seinen Recherche-Touren besucht hat. Im „Protzen“-Kapitel lässt Fontane es offen, „verrät“ sich an einer Stelle dann doch: Erwähnt werden zwei bildliche Darstellungen, die im Sterbezimmer des Prinzen Heinrich an dessen Aufenthalt in Protzen erinnern würden. Ob die Gemälde noch existieren, räumt er ein, hab ich nicht erfahren können. Wäre Fontane im Gutshaus gewesen, wüsste er es.

In die Alltagsgeschichte integriert: Herrscherporträts auf einer Friseurtoilette im Museum Protzen, 2018; Foto: Robert Rauh
Bis 1945 gab es im Herrenhaus tatsächlich ein „Prinzenzimmer“, das die letzte Gutsbesitzerfamilie Legde als Kinderstube für die fünf Söhne nutzte. Heute werden im ehemaligen Prinzenzimmer dörfliche Gewerke wie Schneider, Schuster und Schlachter ausgestellt. Lediglich eine Ecke erinnert an den unfreiwilligen Gast. Auf einer historischen Friseurtoilette befinden sich ein Porträt, ein kurzer Lebenslauf und ausgewählte Dokumente. Es wäre ein Anfang. Der Anspruch des Vereins klingt zwar wie eine Phrase, lässt aber hoffen: „Wir haben schon einiges erreicht und haben noch viel vor.“
Titelbild:
- Gutshaus Protzen, 2017; Foto: Robert Rauh
Literatur: „Wanderungen“
- Fontane, Theodor: Die Grafschaft Ruppin (Wanderungen durch die Mark Brandenburg), 3. Auflage, Verlag von Wilhelm Hertz, Berlin 1875.
Hinweis: Der Ort Protzen, über den keine Fontane-Notizen überliefert sind, wurde erst in der 3. Auflage (1875) in die „Wanderungen“ aufgenommen.
Weiterführende Literatur:
- Rauh, Robert: Fontanes Ruppiner Land, be.bra verlag, Berlin 2019.
- Sachs, Michael: Durchlauchtigster Prinz, freundlich Geliebter Neveu. Heinrich von Preußen (1747-1767). Neffe Friedrich des Großen. Sein Leben und tragischer Tod in Zeitzeugenberichten, alcorde verlag, Essen 2012.
Weblinks
- Website des Vereins Insel e.V. Protzen